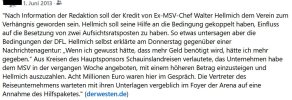Sehr interessant auch der Kommentar, den ein FB-User in die Kommentarspalte von Radio Duisburg in Bezug auf den Podcast gepostet hat:
„Frage an ChATGPT; Wenn aktuelle oder frühere Machthaber (zum Beispiel eines Fußballvereins) von ihrem Versagen ablenken wollen, das zeitlich deutlich in der Vergangenheit liegt. Was sind dann die gängisten rhetorischen Tricks? Beantworte diese Frage unter Beachtung der Grundsätze der Psychologie, der Psychoanalyse, der Tiefenpsychologie und den Erkenntnissen über das Unterbewusstsein?
Antwort: Wenn aktuelle oder frühere Machthaber – sei es in der Politik, Wirtschaft oder in einem Fußballverein – von vergangenen Fehlern oder Versäumnissen ablenken wollen, greifen sie oft auf bewährte rhetorische Strategien zurück. Diese beruhen auf psychologischen Mechanismen, die tief im Unterbewusstsein der Menschen wirken und deren Wahrnehmung gezielt beeinflussen. Hier sind die wichtigsten Techniken im Lichte der Psychologie, Psychoanalyse und Tiefenpsychologie:
1. Projektion (Freud, Psychoanalyse)
Das eigene Versagen wird unbewusst auf andere projiziert.
Beispiel: Statt die eigene schlechte Transferpolitik oder finanzielle Misswirtschaft zuzugeben, wird ein vorheriger Funktionär oder ein „Sündenbock“ für die aktuelle Krise verantwortlich gemacht.
2. Reframing (Kognitive Psychologie, NLP)
Die Deutung eines Ereignisses wird verändert, um es positiver erscheinen zu lassen.
Beispiel: Statt „Wir haben falsche Spieler verpflichtet“ heißt es „Wir haben langfristig gedacht und junge Talente geholt“.
3. Vergangenheitsrelativierung („Es war noch schlimmer!“)
Die eigene schlechte Leistung wird relativiert, indem auf eine vermeintlich noch schlechtere Situation in der Vergangenheit verwiesen wird.
Beispiel: „Bevor wir kamen, war der Verein kurz vor dem Bankrott!“
4. Ablenkung durch emotionale Trigger (Tiefenpsychologie, Bernays, Propaganda-Strategien)
Statt über die eigentlichen Missstände zu sprechen, werden emotionale Themen in den Vordergrund gestellt.
Beispiel: Die Vereinsidentität, Fankultur oder externe „Feinde“ (z. B. „die Medien“, „die Liga“) werden als Ablenkung genutzt.
5. „Wir gegen die anderen“ (Freuds Massenpsychologie, Spaltungstaktik)
Durch die Konstruktion eines äußeren Feindes wird der Fokus von der eigenen Verantwortung abgelenkt.
Beispiel: „Die Presse hat eine Kampagne gegen uns gestartet!“
6. False Dichotomy („Entweder-oder-Falle“, kognitive Verzerrung)
Es wird so getan, als gäbe es nur zwei Alternativen – eine schlechte und die eigene.
Beispiel: „Entweder wir gehen diesen Weg oder wir rutschen in die Bedeutungslosigkeit ab.“
7. Wiederholung und Manipulation des kollektiven Gedächtnisses (Behaviorismus, Konditionierung)
Durch ständige Wiederholung von Narrativen werden diese in den Köpfen der Fans verankert.
Beispiel: „Wir haben den Verein stabilisiert“ – auch wenn die Fakten dagegensprechen.
Fazit
Diese Techniken zielen darauf ab, das Unterbewusstsein anzusprechen, emotionale Reaktionen zu erzeugen und rationale Analysen zu verhindern. Sie funktionieren besonders gut, wenn Menschen bereits in einem emotional aufgeladenen Zustand sind – wie es oft bei Fans eines Fußballvereins der Fall ist.
Nachfrage:
Hast du noch weitere?
ChatGPT:
Ja, es gibt noch viele weitere rhetorische Tricks und psychologische Mechanismen, die genutzt werden, um von vergangenen Fehlern abzulenken. Hier sind einige zusätzliche Techniken aus den Bereichen Psychologie, Psychoanalyse, Tiefenpsychologie und Erkenntnissen über das Unterbewusstsein:
8. Schuldumkehr („Victim Blaming“) – (Psychoanalyse, Abwehrmechanismus)
Die Verantwortung wird auf andere abgewälzt, oft auf diejenigen, die Kritik äußern.
Beispiel: „Die Fans haben mit ihrer Ungeduld unsere langfristige Planung gestört!“
Psychologischer Effekt: Erzeugt kognitive Dissonanz beim Publikum, das sich dann fragt, ob es selbst mitschuldig ist.
9. Strohmann-Argument („Strawman-Fallacy“, kognitive Verzerrung)
Eine überzogene oder verdrehte Version der Kritik wird aufgebaut und dann widerlegt.
Beispiel: Kritiker: „Die Transfers waren schlecht.“ Antwort: „Also wollt ihr, dass wir nur Millionen ausgeben und uns ruinieren?“
Psychologischer Effekt: Die eigentliche Kritik wird entkräftet, indem man sie ins Absurde übersteigert.
10. Verschiebung der Zeitperspektive („Delay-Taktik“, Tiefenpsychologie)
Statt die eigene Schuld einzugestehen, wird auf die Zukunft verwiesen.
Beispiel: „Wir müssen Geduld haben, die Früchte unserer Arbeit sehen wir erst in fünf Jahren.“
Psychologischer Effekt: Fans hoffen weiter und sind weniger kritisch in der Gegenwart.
11. Emotionalisierung durch Pathos und Nostalgie (Freud, kollektives Unterbewusstsein)
Statt rationale Argumente zu liefern, werden Emotionen geweckt, oft durch Bezug auf frühere Erfolge oder Vereinslegenden.
Beispiel: „Dieser Verein hat schon Schlimmeres überstanden – erinnert euch an [Erfolg von vor 30 Jahren]!“
Psychologischer Effekt: Löst eine emotionale Verbindung aus und schwächt rationale Kritik.
12. Ad-hoc-Erfolge hervorheben (selektive Wahrnehmung, Bestätigungsfehler)
Einzelne kleine Erfolge werden übertrieben dargestellt, um größere Misserfolge zu überdecken.
Beispiel: „Schaut doch, wir haben letztes Jahr das Pokal-Viertelfinale erreicht!“ (obwohl der Verein sonst stark abgebaut hat).
Psychologischer Effekt: Verhindert eine ganzheitliche Betrachtung der Lage.
13. Appell an externe Autoritäten („Appeal to Authority“) – (Sozialpsychologie, Milgram-Experiment)
Es wird eine vermeintliche Expertenmeinung genutzt, um die eigene Position zu stützen.
Beispiel: „Experte XY sagt, dass unser Weg der richtige ist!“
Psychologischer Effekt: Menschen vertrauen Autoritäten und hinterfragen weniger.
14. Kontrollierte Selbstkritik („Begrenzte Reue“, Tiefenpsychologie)
Eine kleine, harmlos erscheinende Schwäche wird zugegeben, um von größeren Problemen abzulenken.
Beispiel: „Ja, einige Transfers haben nicht funktioniert, aber das passiert jedem Verein.“
Psychologischer Effekt: Lässt die Führung glaubwürdig erscheinen, ohne dass echte Verantwortung übernommen wird.
15. Polarisierung (Freud, Massenpsychologie, „Divide and Conquer“-Taktik)
Kritiker und Unterstützer werden gegeneinander ausgespielt, um eine gespaltene Fanbasis zu erzeugen.
Beispiel: „Es gibt wahre Fans, die hinter uns stehen – und dann gibt es die ewigen Nörgler!“
Psychologischer Effekt: Menschen wollen nicht als „Nörgler“ gelten und schließen sich der Masse an.
16. Überladung mit irrelevanten Informationen („Informationsflut“, Tiefenpsychologie)
Durch eine Flut an (oft irrelevanten) Zahlen und Fakten wird Kritik erschlagen.
Beispiel: „Wir haben X Jugendspieler eingesetzt, Y Scorerpunkte geholt, Z Passquote – das zeigt, wir sind auf dem richtigen Weg!“
Psychologischer Effekt: Verhindert kritische Reflexion durch kognitive Überforderung.
17. Skandalmanagement durch „größere“ Skandale („Dead Cat Strategy“) – (Politische Rhetorik, Medienpsychologie)
Ein anderes, oft extremeres Thema wird in die Diskussion gebracht, um die eigentliche Kritik in den Hintergrund zu drängen.
Beispiel: Statt über finanzielle Misswirtschaft zu reden, wird eine Fehde mit einem anderen Klub oder ein „Verrat“ eines Spielers medial hochgespielt.
Psychologischer Effekt: Die öffentliche Aufmerksamkeit verlagert sich.
18. Pseudowissenschaftliche Argumente und Mythenbildung („Illusory Truth Effect“, Tiefenpsychologie)
Falschbehauptungen oder Halbwahrheiten werden immer wiederholt, bis sie als Wahrheit akzeptiert werden.
Beispiel: „Es gibt einen geheimen Plan gegen unseren Verein, das sieht man an den Schiedsrichterentscheidungen!“
Psychologischer Effekt: Wiederholung erhöht Glaubwürdigkeit (Verzerrung des Unterbewusstseins)."